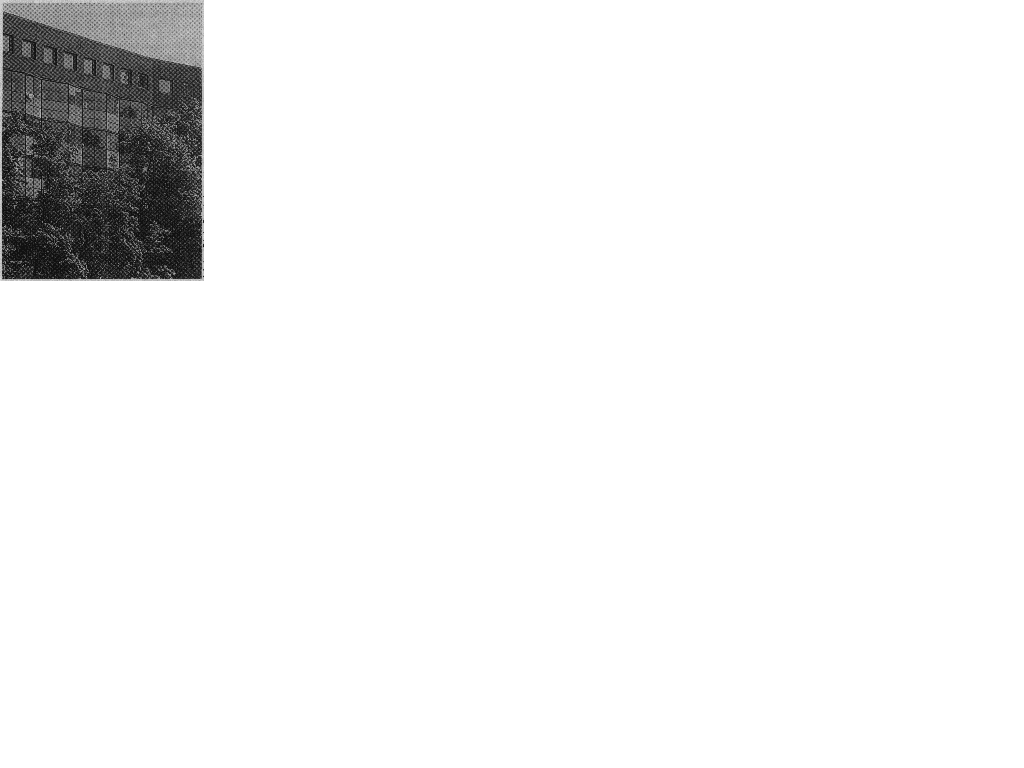
Knick in der Ziehharmonika-Fassade: Wohnhaus in Berlin-Wilmersdorf
|
Berlin und der Streit um seine Architektur: Nicht geschlichtet, nur verwandelt. Unter den Protagonisten: Einer, der auf alte Werte baut Gravitätische Häuser, tanzende SeeleDer Architekt Hans Kollhoff - Im Konventionellen das Eigene entdecken Von Gerwin Zohlen Nicht Häuser, Worte machten den Berliner Architekten Hans Kollhoff berüchtigt. Er nutzte die Gunst der publizistischen Stunde beim "Berliner Architekturstreit" zu einer Art Coup d'Etat. Seine konservative Rhetorik vom "Steinernen Haus" besorgte die offiziöse Baudoktrin für den Berliner Innenstadtaufbau nach dem Mauerfall. Der vorige Senatsbaudirektor Hans Stimmann hatte sie nach kurzer Gegenwehr übernommen. Heute geistert sie verballhornt zur "Steintapete" durch die Debatten. Allemal wurde Kollhoff durch sie zur nationalen Größe, Mitglied einer vermeintlichen Architektenbande (Kleihues, Sawade, Dudler, Kollhoff), die Berlin architektonisch regiere, und sachgemäß auch zum eigentlichen Gegenspieler des amerikanischen Avantgarde-Architekten Daniel Libeskind (ZEIT Nr. 29/96), zumindest ideologisch. Im Ballett der Formeln und Statements vollführten die beiden einen gekonnten Pas de deux. Forderte Libeskind das unbedingte Neue in Architektur und Städtebau, berief Kollhoff sich auf handwerklich durchdachte Bauprozesse; trat Libeskind unter der unausgesprochenen Parole "Kunst und Zeichnung" an, beharrte Kollhoff gleichsam auf dem Maurerkalk, der auch an den Schuhen von Großarchitekten kleben solle - kurz, zwischen beiden war der alte, so schön alte Konflikt der Altvorderen gegen die Neuerer aufgebrochen und unterderhand damit auch der zwischen Kunst und Wirklichkeit. Kollhoffs Architektenruhm haben vor allem die beiden Häuser in Berlin-Charlottenburg am Luisenplatz (1987) und auf der ehemaligen Hafeninsel der Königlich-Niederländischen Schiffahrtgesellschaft (KNMS) in Amsterdam (1995) gefestigt. Beides sind öffentlich finanzierte Wohnbauten, und beide bewegen sich in den Dimensionen eines ganzen städtischen Blocks. Aber durch die plastische und skulpturale Verformung der Baukörper geraten diese Blocks, in Berlin sogar das umgebende Quartier atmosphärisch ins Schwingen. Der Luisenplatz liegt (wie Berlin) an der Spree, dem barocken Schloß Charlottenburg unmittelbar benachbart. Mit einem weiten, eleganten Schwung scheint Kollhoffs Bau Schloß und Park umfassen zu wollen. An den Häusern - dem Hauptgebäude und einem Appendix zur Spree hin - begrenzt ein strenger Rahmen blauvioletter Klinker die vier Stockwerke hohen Glaswände, hinter denen sich Wintergärten und Balkonwege vorm Straßenlärm schützen. Selbstbewußt spielt Kollhoff mit Architekturmotiven der 20er-Jahre-Moderne. An der einen Schmalseite geleiten Balkonschwünge wie von Erich Mendelsohn in eine mehrspurige Verkehrsachse, und obenauf winkt eine Art Flugzeugflügel Grüße an Le Corbusier. Kollhoff benutzte hier zum erstenmal den dunklen Klinker. Akribisch vermerkt, stammt er noch aus Torfbrandziegeleien Norddeutschlands; handgestrichen, sagen die Fans. Auch wenn er ihn natürlich weder erfunden noch eigentlich wiederentdeckt hat, wurde er sein Markenzeichen und hat viel zu den ideologischen Verdächtigungen, vor allem aber zu seiner Etikettierung als Steinerner Architekt beigetragen. Marktgemäß taucht er auch beim Amsterdamer Haus wieder auf. Doch wie anders ist er dort verwendet. Hat er in Berlin die bildhafte Funktion, die Glaswand zu rahmen, so kommt ihm in Amsterdam die Aufgabe zu, dem riesigen und in sich vielfach geknickten und durchstoßenen Baukörper eine Haut zu geben, die ihn zusammenhält. Als drittes Beispiel noch ein vergleichsweise kleines Haus, aber in sozusagen verzweifelter Lage in Berlin-Wilmersdorf (1995). Der langgestreckte Bau steht mit Klinkerrahmen und Glaswand vor den Wintergärten unmittelbar an der Stadtautobahnausfahrt Hohenzollerndamm. Unverzichtbar ist die lärmschützende Aufgabe, da auch die S-Bahn noch vorm Haus vorbeifährt. Mit einem kleinen Knick brachte Kollhoff Bewegung in den Bau. Just an der Böschung zum Auto- und S-Bahngraben nämlich stehen ein paar Bäume. Ihnen weicht der Baukörper ins Dreieck aus. Die (theoretisch) dabei auftretenden Druckkräfte werden in der Glaswand ausgeglichen, indem sie sich wie eine Ziehharmonika faltet: so simpel wie plausibel, so sehr Architektur. Alle diese Bauwerke sind unverkennbarer Kollhoff, und doch ist an ihnen nichts Stil oder der Wille dazu. Am ehesten kann man einen unbedingten Willen zur Qualität entdecken. Und sind die Details das Sinnfällige an Architektur, das die Bewohner betrifft, so Baukörper und Figur das Augenfällige, das die Stadt angeht. Ganz klar aber ist auch, daß alle diese großen seriösen und in sich auch gravitätischen Häuser so etwas wie eine tanzende Seele enthalten, die sie über die pure Zweckerfüllung, Wohnungen zu stapeln, hinaushebt: Architektur also, die diesen Namen wirklich verdient. Hans Kollhoff wurde 1946 in Lobenstein (Thüringen) geboren. Im Gefolge der Landwirtschaftskollektivierung in der DDR floh die Familie nach Westdeutschland. Er studierte in Karlsruhe und Wien Architektur. 1975 gelangte er mit einem DAAD-Stipendium an die Cornell University, New York. Dort assistierte er dem Kölner Architekten Oswald Mathias Ungers, der seinerzeit in den USA lehrte. Nach mehreren Gastprofessuren unterrichtet Kollhoff seit 1990 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Sein Büro führt er seit 1984 gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Helga Timmermann in Berlin. Kollhoffs wichtigster Lehrer Ungers genießt unter Architekten einen fast mythischen Ruf. Stupende Intellektualität und Bildung kennzeichnen ihn ebenso wie ein eisiger ästhetischer Idealismus (im philosophischen Sinne), unter Fachleuten als Rationalismus bekannt. Fast unweigerlich führt der ihn zur harten, apriorischen Schönheit geometrischer Grundformen (vor allem des Quadrats). Kollhoff hat von ihm nicht die klassizistische Formensprache, wohl aber die Unbedingtheit im Metier übernommen. Während bei Ungers jedoch die Radikalität der Kunstidee hervorsticht, äußert sie sich bei Kollhoff als Intensität, die aufs Materiale und Handwerkliche gerichtet wird. Er regiert nicht über abstrakte Formen, sondern versenkt sich energisch in die jeweilige Aufgabe, um im Konventionellen das Eigene zu entdecken und daraus das Konventionelle zu formen. Diese Transformationsprozesse lassen ihn als Architekten so herausragen. Grundsätzlich ist man bei Kollhoff zur Auseinandersetzung mit einer architektonischen Haltung gefordert, nicht zur Bewertung eines Stilrepertoires. Und aus solchen kunstphilosophischen Gründen ist er paradoxerweise moderner als sein Kontrahent Daniel Libeskind, der mit dem Kategorienbesteck des 19. Jahrhunderts, dem Individualstil nämlich operiert. Gleichviel - ziemlich genau an dieser Stelle schlug die Glocke des Architekturstreits. Unterm Strich kam dabei nur der Streit um das Fassadenmaterial - Stein oder Nichtstein - an. Verhandelt aber wurden die Fragen der architektonischen Modernität und der Stadt; keine unerheblichen Fragen fürwahr. Rhetorisch ist Kollhoff ebensowenig ein Softie wie architektonisch. Die diplomatische Girlande liegt ihm nicht, eher das Bekenntnis. Stur weigert er sich, dem Splittergeist Gegenwart bloß zu willfahren. In seinen Statements und Artikeln zwischen 1992 und 1994 trat er unverblümt, manchmal auch geifernd auf: ein Wertkonservativer, der die Besinnung auf Solidität und Dauerhaftigkeit, auf die traditionellen Werte des Hausbaus einklagte, Alles schnell Modernistische überzog er mit bitterer Polemik und agierte heftig gegen eine Avantgarde, die mit bunten Metallen und Gläsern zu zerstören droht, was ihm am Herzen liegt. Nein, sagt Kollhoff, fest gegründet soll ein Haus sein, das er Stadt und Bewohnern überantworten will. Und schaffte es, die komplexen Probleme des Städtebaus auf die Frage zu reduzieren, ob eine Sockelgesteins- oder Mauerwerksfuge auch tatsächlich mit Mörtelzement geschlossen wird oder nur die Mimikry ans Solide betreibt. GewiB, es ging in Berlin nach 1989 auch für Architekten um sehr viel Geld. Doch nach den langen Debatten über die zerstörten, die "gemordeten Städte" schien es zu kommun, daß die Moderne in Architektur und Städtebau einer Neuformulierung bedarf; daß nicht unser aller Zauberbesen des Industriezeitalters, das Auto, sondern die (guten) Lebensmöglichkeiten eine weitere Entwicklung der Stadt bestimmen sollten. Doch als Kollhoff 1992 (im Berliner Tagesspiegel und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) eine Art von Publikumsbeschimpfung der Architektur veröffentlichte, in der er weder Hausbewohner noch Kollegen, weder Investoren noch gar die Verwalter in öffentlichen Amts- und Wettbewerbsstuben aussparte und sich über die "Zumutungen der Silikonspritzen- und Thermohautarchitektur" erregte, mit empörtem Unterton und jungmännisch wehendem Mantel die sinnlichen und handwerklichen Qualitäten alter Holzfenster und wilhelminischer Steinhäuser als die besseren Antworten dagegensetzte - da rastete der Antivergangenheitsaffekt von Zunft- und Fachkritikern ein. Kollhoff war nicht mehr nur der gemäßigte Antipode des Avantgardisten Daniel Libeskind, sondern wurde in der öffentlichen Meinungsbildung zu einer Art Erzfeind der Gegenwart, zum Vergangenheitsbeschwörer, später natürlich auch zum Faschisten. Unübersichtlich wurde die Lage, als Kollhoff die ihm zufallende Rolle gemäß seinem Naturell offensiv übernahm. Nicht nur in Worten. Zum Ergänzungswettbewerb der Berliner Museumsinsel (1993; Bode-, Pergamon-, Altes Museum und Nationalgalerie) legte er das Konzept einer Entréehalle aus durchscheinendem Marmor vor, deren Höhe und Fügung bruchlos die Marmororgie der Speerschen Reichskanzlei fortsetzt - ein unhaltbarer, in manchem auch unfaßlicher Entwurf, der nur psychologisch, als Sarkasmus zu verstehen ist. Das allgemeine Problem im Hintergrund der Debatte war (und ist), daß es anders als nach dem Ersten Weltkrieg gegenwärtig keine architektonische Moderne gibt, die sich aus sich heraus im Material erklärt oder aus der kulturellen Stimmungslage von selbst versteht, also keine, die evident oder auch nur plausibel wäre. Kollhoff antwortet auf dieses kulturelle Dilemma mit dem Programm vom Steinernen Haus. Das hat einen Fallstrick: Für exquisite architekturhistorische Kenner mag es überflüssig sein, über den internen Verweis auf Le Corbusiers Ästhetik und Programm der zwanziger Jahre aufzuklären. Für die übrige Mehrheit jedoch sollte angemerkt werden, daß es sich dabei im wesentlichen um die Stadt und ihre Anlage selbst handelt. Le Corbusier nämlich kannte in seiner Ästhetik und Theorie zeitlebens vor allem das Feindbild des Steinernen Hauses in der rue corridor, die Wohnblocks mit Innenhöfen, Fassade zur dichten Atmosphäre der Straßen. An ihrer Stelle wollte er: die aufgeständerten Wohnscheiben im Umgebungsgrün, das hineinfließen der Landschaft in die Stadt - kurzum, Kollhoffs Programm ist eine Revision der vielbesprochenen Stadtfeindschaft der orthodoxen Moderne, die in Le Corbusiers Schatten wuchs. Er lief aber nicht zurück ins strahlende und unglückliche "lange", das 19. Jahrhundert. Er berief sich auf einen frühen Kritiker an den ästhetizistischen Erstarrungen der Moderne, auf Adolf Behne, dessen kunstphilosophisches Credo - das einzig Soziale an Kunst und Architektur sei ihre Form - er wieder fruchtbar machen wollte. Der Hauptgedanke des Kollhoffschen Programms mithin ist: die städtischen Rücksichten vor die Ausdrucksgebärden einzelner Architekten zu plazieren. Die Stadt ist für ihn ein - architektonisch - unteilbares Ganzes, das den höheren Respekt vor der individuellen Kunstfreiheit verdient. Gesagt ist damit auch, daß für Kollhoff nicht die jeweilige Bauaufgabe, ihre formale Durcharbeitung oder das Fassadenmaterial der gedankliche Rahmen sind, in dem er sich bewegt. Es ist die gesamte Stadtfläche, nach der er seine Entwürfe qualifiziert. Und auch deswegen unterscheiden sich seine Arbeiten für Berlin-Hohenschönhausen so kraß von denen für Charlottenburg oder Moabit, in Amsterdam von denen am Berliner Alexander- und Potsdamer Platz. Bleibt die Stadt. Urbanität ist heute in aller Munde. Sie heißt, wörtlich übersetzt, "Städtischkeit", wirft also qualitative Fragen nach den Mentalitäten, Verhaltensweisen und dem Gebrauch des öffentlichen Raums der Stadt auf. Urbanität siedelt im Innersten der Gesellschaft, ist sozusagen nichts außer ihr. Dazu aber leistete der Berliner Architekturstreit so gut wie nichts - eher schon das Gegenteil. Wohl wahr - Kollhoffs Verhältnis zur Stadt ist konservativ. Die Probleme dieser Haltung sind einer sonderbaren Antwort Kollhoffs auf das heraufziehende Elektronikzeitalter zu entnehmen. Stadt, schreibt er, sei die Gesellschaft der Häuser. Diese Definition ist wunderschön, Nur bieten die Häuser einer Stadt bestenfalls das Bild, nie die Gesellschaft selbst. Der intrikate Nebensinn besagt, daß Kollhoffs Position eine Kulturästhetik enthält, die sich der Enttäuschung und dem Verlust verdankt. Wer die Gesellschaft verlor, hält sich ans Stumme, die Häuser. Er will unserer Gegenwart das Bild einer Urbanität verleihen, die es in der sozialen Realität so nicht mehr gibt, die nur noch als Kleingeld des regionalen und lokalen Marketings ausgeteilt wird. Am Ende schließlich kommt man um das Hochhausthema nicht herum. Mit ihm wurde Kollhoff der breiteren Öffentlichkeit bekannt, und damit erlebte er eine der vielleicht folgenschwersten Niederlagen seiner Karriere. 1991 trat er zum Auftakt der großen Berliner Städtebau-Konkurrenzen am Potsdamer/Leipziger Platz mit einem Hochhausentwurf an. Sieben Wolkenkratzer nach Chikagoer Vorbild der dreißiger Jahre sollten den Potsdamer Platz westlich umkränzen, während der Leipziger Platz und die angrenzenden Reste der barocken Friedrichstadt in den tradierten Höhen und Blockgrößen "kritisch", wie es offiziös hieß, rekonstruiert werden sollten; also heutige Architektur in alten Strukturen. Es war ein formidabler Entwurf. Er hat sozusagen alles im Blick gehabt, was für den Ort und für Berlin von wirklicher Bedeutung war: die politische Geschichte der Ost-West-Spaltung, die stadtbaugeschichtliche Situation mit dem Aufeinandertreffen von geschlossenem, barocken Stadtraum der Berliner Altstadt und seinem ideologisch krude aufgelassenen Erbe am Kulturforum (Staatsbibliothek, Philharmonie). Er ließ sich auch nicht vom Mythos des Potsdamer Platzes der zwanziger Jahre beirren, sondern reagierte funktional und eigenständig auf die neuen Nutzungsanforderungen nach dem Mauerfall. Den Spielregeln des Wettbewerbsverfahrens zufolge wurde Kollhoffs Entwurf blamabel ausgebootet, obwohl seine Qualitäten selbst in der Wettbewerbsjury anerkannt wurden. Doch fiel die Entscheidung politisch. Ihre Botschaft lautete: "Gegen Hochhäuser in der inneren Stadt". Maßgeblich dirigierte sie der damals frisch ins Amt gekommene Senatsbaudirektor Hans Stimmann. Und im Blick auf die folgende Berliner Bauentwicklung ist es wohl seine gröbste Fehlentscheidung gewesen. Die Niederlage am Potsdamer/Leipziger Platz hat Kollhoff nicht materiell geschadet In einem Aufsehen erregenden Verfahren erhielt er 1994 den Planungsauftrag für den spätestens seit Alfred Döblin literaturnotorischen Alexanderplatz am östlichen Rand der Berliner Innenstadt. Über die DDR-Baugeschichte hinweg tritt er damit die Erbschaft von Peter Behrens an. Kollhoff faßt den heutigen Un-Platz mit einem Dreiviertelkranz von zwölf mittelhohen Hochhäusern (etwa 130 Meter). Ihr Trick ist architektonisch: Sie erheben sich aus den "straßenständigen" Blockbauten, so daß sie vom Platz aus nicht wirklich zu sehen sein werden. Das städtebauliche Reflexionsniveau vom Potsdamer/Leipziger-Platz-Entwurf jedoch hält dieser Plan nicht. Fragt man Kollhoff heute danach, antwortet er grummelnd, man habe das Eigenständige nicht gewollt, sondern die neue Konvention. Und hier ist Gefahr im Verzuge, da diese neue Konvention bei Lichte besehen ein Konformismus ist: Konventionen bilden sich, sie werden nicht per Dekret beschlossen. Das spürt man an Kollhoffs Arbeiten. Sie scheinen seither vor allem die kulturpolitisch zugespitzten Thesen von Stein und Wand zu illustrieren. Dabei verwechselt er die Eigenarten seiner Arbeitsweise mit den Geboten einer normativen Ästhetik. Das ist falsch gedacht und schade. In jedem seiner Häuser, die ich kenne, gibt es Ecken, Winkel, Räume, die das berühmte Ziehen im Solarplexus auslösen; das kleine Sehnen der Phantasie, sich einrichten zu wollen. Es rührt daher, daß er bisher in seinen Entwürfen tanzte, um aus dem spröden (Stein-)Material den Charme des Handwerks und der urbanen Figur zu befreien. Das beglückte und weckte im Ernst der städtischen Lage das Lächeln vergehender Schönheit. |
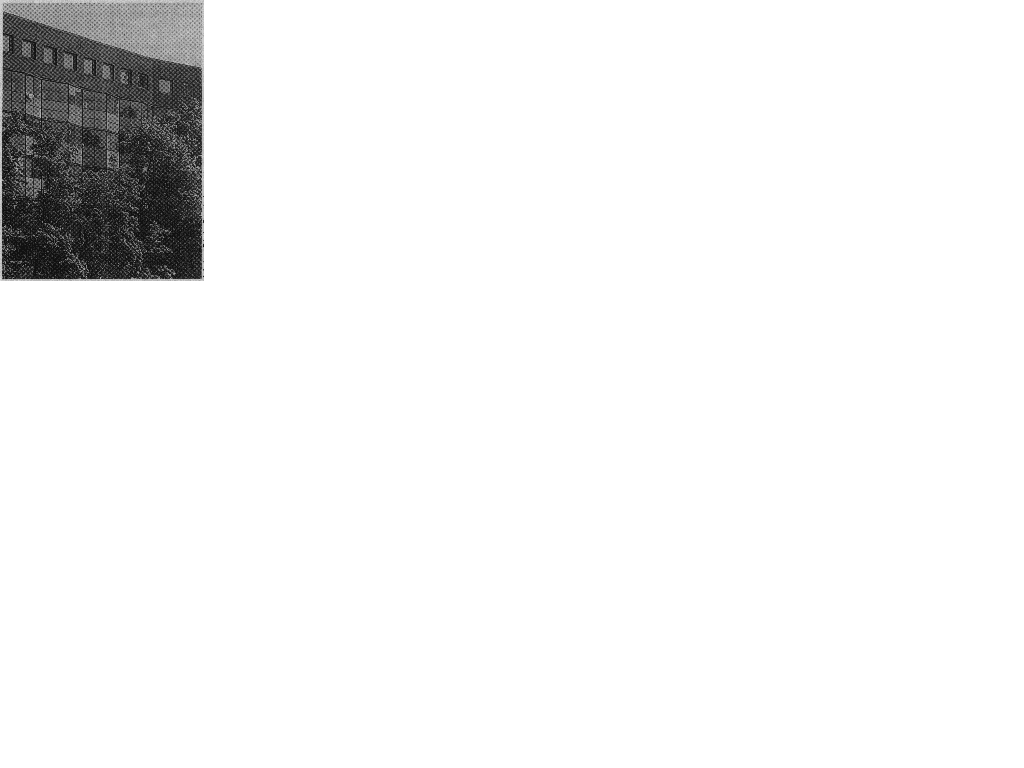
Knick in der Ziehharmonika-Fassade: Wohnhaus in Berlin-Wilmersdorf
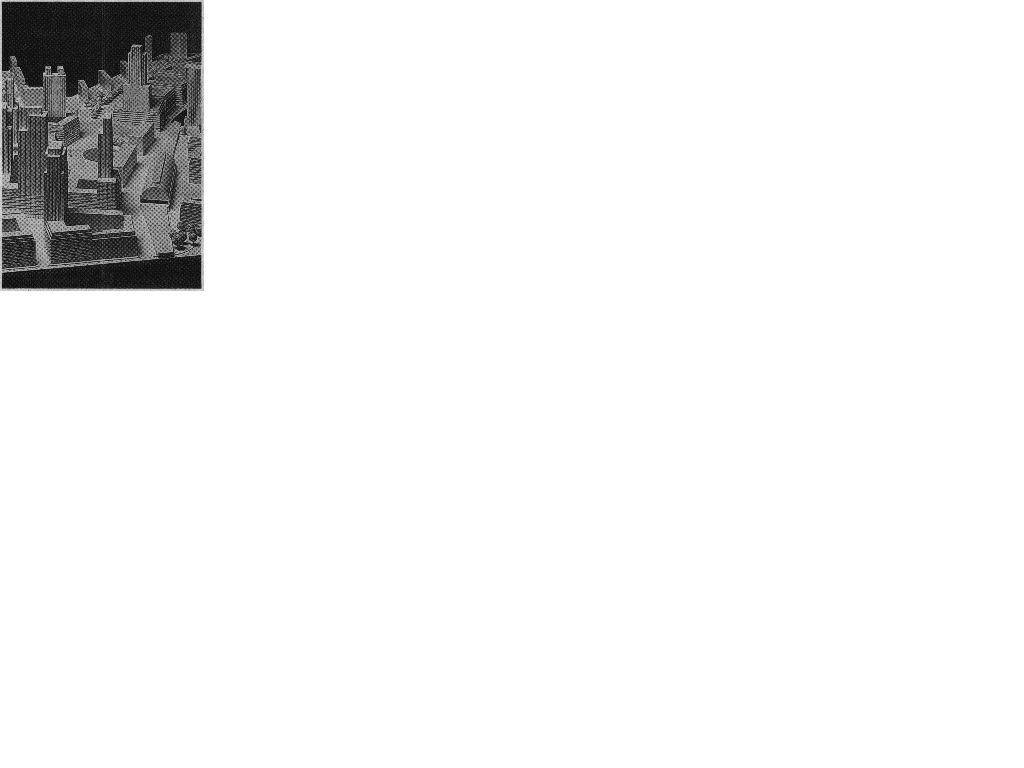
Das Modell von Kollhoffs Alexanderplatz
DIE ZEIT Nr. 37, p. 54, 6.9.1996
Aufnahme: Eric-Jan Ouwerkerk